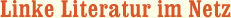Michelangelos Moses und Freuds ’Wagstück’
Alle Preise inkl. MwSt.
| zzgl. Versand
Nicht verfügbar
Zum Merkzettel
Gewicht:
434 g
Format:
235x188x35 mm
Beschreibung:
Grubrich-Simitis, IlseIlse Grubrich-Simitis, Psychoanalytikerin. Zuständig für die Edition von Sigmund Freuds Werk im S. Fischer Verlag. Ihre Veröffentlichungen zur Freud-Forschung, darunter 'Zurück zu Freuds Texten' (1993), sowie zu Theorie und Klinik der Psychoanalyse sind in viele Sprachen übersetzt worden, 1998 Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.Literaturpreise:Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1998Mary S. Sigourney Award 1998
Warum Michelangelos Moses uns heute in Bann schlägt und warum Freud mit seiner Deutung irrte
Warum Michelangelos Moses uns heute in Bann schlägt und warum Freud mit seiner Deutung irrte
In ihrer Collage, die Text und Bild auf innovative Weise miteinander verbindet, erzählt Ilse Grubrich-Simitis zuerst die Geschichte des sprachmächtigen Freudschen Essays über den Moses des Michelangelo. 1912 bis 1914, in den Jahren der Auseinandersetzung und des schließlichen Bruchs mit C.G. Jung, war Freud von diesem Bilderwerk regelrecht besessen. In Gestalt der Deutung - der Künstler zeige einen Moses, der angesichts seines um das Goldene Kalb tanzenden Volkes, entgegen dem Bibelwortlaut, sich nicht dazu hinreißen lasse, die Gesetzestafeln im Zorn zu zerschmettern - erschuf sich der Begründer der Psychoanalyse in einer persönlichen Krise ein haltgebendes Vorbild der Selbstbeherrschung im Dienste der Fortsetzung des eigenen Lebenswerks. Dabei übersah er freilich sprechende, seiner Deutung widersprechend Details.
Laut einer neueren, stimmigeren Interpretation des Kunsthistorikers Franz-Joachim Verspohl zeigt Michelangelo den Moses nach einer späteren Unterredung mit Gott, in deren Verlauf ihm sein bevorstehendes Ende verkündet wird. So gesehen, wurzelt die unerhörte, unvergängliche Wirkung der Statue in der meisterlichen Darstellung des Schreckens angesichts von Gebrechlichkeit und Sterblichkeit des Menschen sowie Zähmung dieses Schreckens. Die Autorin zeigt am Ende nicht nur Berührungspunkte zwischen beiden Deutungen; sie nennt auch moderne Gründe dafür, in unserer Zeit einer rasanten kulturellen Regression von Michelangelos Moses als Repräsentanten ethischer Prinzipien und des "Fortschritts in der Geistigkeit" sich ergreifen zu lassen.
Laut einer neueren, stimmigeren Interpretation des Kunsthistorikers Franz-Joachim Verspohl zeigt Michelangelo den Moses nach einer späteren Unterredung mit Gott, in deren Verlauf ihm sein bevorstehendes Ende verkündet wird. So gesehen, wurzelt die unerhörte, unvergängliche Wirkung der Statue in der meisterlichen Darstellung des Schreckens angesichts von Gebrechlichkeit und Sterblichkeit des Menschen sowie Zähmung dieses Schreckens. Die Autorin zeigt am Ende nicht nur Berührungspunkte zwischen beiden Deutungen; sie nennt auch moderne Gründe dafür, in unserer Zeit einer rasanten kulturellen Regression von Michelangelos Moses als Repräsentanten ethischer Prinzipien und des "Fortschritts in der Geistigkeit" sich ergreifen zu lassen.