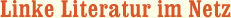Versprechungen des Ästhetischen
Die Entstehung eines modernen Bildungsprojekts
Paperback
Print on Demand | Lieferzeit: Print on Demand - Lieferbar innerhalb von 3-5 Werktagen I
Alle Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Nicht verfügbar
Zum Merkzettel
Gewicht:
411 g
Format:
210x148x18 mm
Beschreibung:
PD Dr. Ehrenspeck-Kolasa, Yvonne G. ist Oberassistentin am Institut für Allgemeine Pädagogik der Freien Universität Berlin.
0 Einleitung.- 1. Kants transzendentale Grundlegung der Autonomieästhetik der Moderne in der "Kritik der Urteilskraft" als Voraussetzung eines neuen Bildungsprojekts - Rekonstruktion der Ansatzpunkte für die "Versprechungen des Ästhetischen".- 1.1 Anthropologie, Pädagogik und Transzendentalphilosophie.- 1.2 Ästhetik als "Übergang". Die transzendentale Vermittlungsfunktion des "Ästhetischen".- 1.3 Die Begründung der Autonomie des Ästhetischen durch das apriorische Prinzip der Urteilskraft.- 1.4 Das reine Geschmacksurteil.- 1.5 Die Abstraktion von materialen Empfindungen im ästhetischen Reflexionsurteil als Bedingung der Konstitution der Autonomie des Ästhetischen.- 1.6 Die Begründung der "allgemeinen Mitteilbarkeit" des ästhetischen Reflexionsurteils.- 1.7 Die Idee der "allgemeinen Stimme" und ihre Beziehung zum Intelligiblen.- 1.8 Das Schöne als "Symbol des Sittlich-guten" und das Erhabene. Das Problem von Reflexion und Darstellung.- 1.9 Zusammenfassung der rekonstruierten Ansatzpunkte für die "Versprechungen des Ästhetischen" und der Analyse der transzendentalen Grundlegung des Ästhetischen als Voraussetzung für eine Bildungsaspiration der Moderne.- 2. Krisenerfahrung und "Wirklichkeitsmangel". Schillers neuhumanistische Bildungstheorie des Ästhetischen als Antwort auf die Kantische Transzendentalphilosophie.- 2.1 Schillers Umdeutung des Begriffs "Übergang".- 2.2 Schillers Idee einer "gemischten Natur" als Versuch einer Aufhebung des Kantischen Dualismus.- 2.3 Ästhetische Urteilskraft und praktische Vernunft. "Schönheit als Freiheit in der Erscheinung".- 2.4 Die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Freiheit" als argumentationslogisches Problem.- 2.5 "Natur", "Kunst", "Freiheit" und"Person".- 2.6 Das Schöne als Selbstdarstellung der praktischen Vernunft.- 2.7 Schillers ästhetische Anthropologie.- 2.8 Die "ästhetische Erziehung des Menschen".- 2.9 Das Erhabene als "Ästhetik des Scheiterns" und der sentimentalische Blick auf die Natur.- 2.10 Ästhetik als Bildungsprojekt.- 2.11 Ästhetik und "Identität".- 2.12 "Ästhetische Erziehung" als Kultivierung und "Sublimation".- 3. Romantische "Kunstreligion" und die Ablösung des subjektiven Idealismus der Transzendentalphilosophie Kants und Schillers durch die identitätsphilosophische Ästhetik und Naturphilosophie Schellings und ihr Einfluß auf die Pädagogik der Romantik und die Reformpädagogik.- 3.1 Ästhetik und romantische "Bewegung".- 3.2 Die Überwindung der Dualismen Sinnlichkeit und Vernunft, Geist und Natur und das Versprechen auf ästhetische Versöhnung.- 3.3 Kunst als Darstellung des Absoluten und das Problem der Differenz von Darstellung und Begriff.- 3.4 Fragment, Ironie und "Vernunftkritik".- 3.5 Kunst als höchstes "Organon".- 3.6 Romantische "Kunstreligion" und auf Dauer gestellte Gottwerdung als ästhetische Bildungsaufgabe.- 3.7 Das Naturschöne als "Romantiknatur" und der Organismusbegriff der Naturphilosophie Schellings.- 3.8 Exkurs: Die Wiederkehr romantisch-ästhetischer Motive in der Reformpädagogik, der Lebensphilosophie und in der Bauhauspädagogik.- 3.9 Ästhetik und Pädagogik der Romantik.- 3.10 "Ästhetische Subjektivität" als pädagogisches Problem.- 4. Herbarts "Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung": Zur Implementation des Ästhetischen in die wissenschaftliche Pädagogik der Moderne.- 4.1 Herbarts Erweiterung der Pestalozzischen Anschauungslehre um"ästhetische Wahrnehmung" als Grundlage der Genese von Sittlichkeit.- 4.2 Das "ethisch-edukative Dilemma". Herbarts Kritik an der Freiheitsphilosophie Schellings, Fichtes und Kants vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von "Bildsamkeit" und "Ästhetik" und die Grundlegung einer wissenschaftlichen Pädagogik.- 4.3 Die ästhetische "Näthigung".- 4.4 Ästhetik und Ethik: Die Ideenlehre der "Allgemeinen praktischen Philosophie".- 4.5 Pädagogik und "Ästhetik". Ästhetische Werturteile und "ästhetische Darstellung" der Welt als das "Hauptgeschäft der Erziehung".- 5. Zusammenfassung und Ausblick.- 6. Literatur.
Spätestens am Beginn der 80er Jahre dieses Jahrhunderts entstand in den Geistes-und Sozialwissenschaften eine Renaissance des Ästhetischen, die bis heute andauert. Der Ästhetik wird, besonders unter dem Eindruck von Sinn verlust und Orientierungslosigkeit, eine besondere Leistungsfähigkeit zuge schrieben. Sie wird, beginnend bei speziellen Kunst-und Musiktherapien bis hin zur "Ästhetisierung des Alltags" als Mittel gegen gesellschaftliche und individuelle Probleme, seien es Jungendgewalt, Naturzerstörung, kulturelle Integration, Beziehungsschwierigkeiten oder Neurosen angeboten. Diese Beispiele stehen für ein Phänomen, welches in diesem Buch mit der Wen dung "Versprechungen des Ästhetischen" gekennzeichnet wird. Diese Ver sprechungen werden heute in vielen gesellschaftlichen Bereichen als Innova tion offeriert und gefeiert, so daß der Eindruck vermittelt wird, daß das Medium des Ästhetischen zu keinem früheren historischen Zeitpunkt für sol che ethischen Absichten zur Verfügung gestanden habe. Dieser Eindruck ist indessen völlig falsch. Um zu zeigen, daß diese "Versprechungen des Ästhetischen" viel älter sind, ja daß diese Verspre chungen einen Toposcharakter haben, der besonders in gesellschaftlichen Krisenlagen eingesetzt wird, rekonstruiert Yvonne Ehrenspeck die Geschich te dieser Versprechungen seit dem Beginn ihrer modernen Version am Ende des 18. Jahrhunderts. Dieser Beginn lag in der Transzendentalphilosophischen Grundlegung des Ästhetischen bei Kant, eine Konzeption, die keineswegs, wie besonders in der "postmodernen" Ästhetikrezeption gern behauptet, als gesellschaftli ches Versprechen intendiert war, sondern als systematisches Schlußstück für die Transzendentalphilosophie Kants. Das Buch zeigt, wie dieses systemati sche Interesse Kants durch Schillers Ästhetik gewissermaßen zweckentfrem det wird.