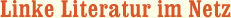Werner Egk: Eine Debatte zwischen Ästhetik und Politik
Alle Preise inkl. MwSt.
| zzgl. Versand
Nicht verfügbar
Zum Merkzettel
Gewicht:
285 g
Format:
20.50x14.50x1.60 cm
Beschreibung:
Autoren in der Reihenfolge ihrer Beiträge: Albrecht Dümling · Robert Braunmüller · Boris von Haken · Jan Thomas Schleusener · Monika Woitas · Ulrike Stoll · Jürgen Schläder · Klaus Kanzog
Werner Egk war ein Mann von ungewöhnlicher Reputation: Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, Präsident des Deutschen Musikrates und Vorstandsvorsitzender der GEMA, sowie Präsidenten der CISAC, der internationalen Dachorganisation für den Schutz der Urheberrechte - Ausweis des Ansehens und Vertrauens, das Werner Egk in der Kulturpolitik genoß.
Ähnliches gilt auch für den Komponisten Egk, wenngleich vor gänzlich anderem Hintergrund. Das Urteil über Egks Bühnenwerke lag von Anbeginn fest: Seine Musik "öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war." Irrtum: Egks Musik entspricht keineswegs jener musikalischen Moderne, die unter das Nazi-Verdikt fiel. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifikationen jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertrat. Daß solche Musik nach 1945 in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spiegelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer Instrumentalisierung, die mit einem derartigen Gesamtwerk verknüpft ist. Dies wird in einigen Beiträgen dieses Bandes verhandelt.
Brisanter ist die redliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer stand ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk und die Konfiszierung seines halben Vermögens als Sühne für Nazi-Mitläufertum zur Debatte. Egk ging in die Offensive und beantragte eine Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesamten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Verbrechen ein ursächlicher Zusammenhang nachzuweisen sei. Diese infame Wendung führt mitten hinein in die Debatte um Ästhetik und Politik. Es wird in diesem Band geklärt, welche ästhetischen Phänomene Egks Musik dominieren, wie sie zu bewerten und zu politischen Fakten und Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Die Aufgabe ist schwierig, aber sie anzugehen lohnt. Werner Egk war ein Mann von ungewöhnlicher Reputation: Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, Präsident des Deutschen Musikrates und Vorstandsvorsitzender der GEMA, sowie Präsidenten der CISAC, der internationalen Dachorganisation für den Schutz der Urheberrechte - Ausweis des Ansehens und Vertrauens, das Werner Egk in der Kulturpolitik genoß.
Ähnliches gilt auch für den Komponisten Egk, wenngleich vor gänzlich anderem Hintergrund. Das Urteil über Egks Bühnenwerke lag von Anbeginn fest: Seine Musik "öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war." Irrtum: Egks Musik entspricht keineswegs jener musikalischen Moderne, die unter das Nazi-Verdikt fiel. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifikationen jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertrat. Daß solche Musik nach 1945 in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spiegelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer Instrumentalisierung, die mit einem derartigen Gesamtwerk verknüpft ist. Dies wird in einigen Beiträgen dieses Bandes verhandelt.
Brisanter ist die redliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer stand ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk und die Konfiszierung seines halben Vermögens als Sühne für Nazi-Mitläufertum zur Debatte. Egk ging in die Offensive und beantragte eine Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesamten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Verbrechen ein ursächlicher Zusammenhang nachzuweisen sei. Diese infame Wendung führt mitten hinein in die Debatte um Ästhetik und Politik. Es wird in diesem Band geklärt, welche ästhetischen Phänomene Egks Musik dominieren, wie sie zu bewerten und zu politischen Fakten und Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Die Aufgabe ist schwierig, aber sie anzugehen lohnt.
Ähnliches gilt auch für den Komponisten Egk, wenngleich vor gänzlich anderem Hintergrund. Das Urteil über Egks Bühnenwerke lag von Anbeginn fest: Seine Musik "öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war." Irrtum: Egks Musik entspricht keineswegs jener musikalischen Moderne, die unter das Nazi-Verdikt fiel. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifikationen jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertrat. Daß solche Musik nach 1945 in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spiegelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer Instrumentalisierung, die mit einem derartigen Gesamtwerk verknüpft ist. Dies wird in einigen Beiträgen dieses Bandes verhandelt.
Brisanter ist die redliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer stand ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk und die Konfiszierung seines halben Vermögens als Sühne für Nazi-Mitläufertum zur Debatte. Egk ging in die Offensive und beantragte eine Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesamten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Verbrechen ein ursächlicher Zusammenhang nachzuweisen sei. Diese infame Wendung führt mitten hinein in die Debatte um Ästhetik und Politik. Es wird in diesem Band geklärt, welche ästhetischen Phänomene Egks Musik dominieren, wie sie zu bewerten und zu politischen Fakten und Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Die Aufgabe ist schwierig, aber sie anzugehen lohnt. Werner Egk war ein Mann von ungewöhnlicher Reputation: Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, Präsident des Deutschen Musikrates und Vorstandsvorsitzender der GEMA, sowie Präsidenten der CISAC, der internationalen Dachorganisation für den Schutz der Urheberrechte - Ausweis des Ansehens und Vertrauens, das Werner Egk in der Kulturpolitik genoß.
Ähnliches gilt auch für den Komponisten Egk, wenngleich vor gänzlich anderem Hintergrund. Das Urteil über Egks Bühnenwerke lag von Anbeginn fest: Seine Musik "öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war." Irrtum: Egks Musik entspricht keineswegs jener musikalischen Moderne, die unter das Nazi-Verdikt fiel. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifikationen jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertrat. Daß solche Musik nach 1945 in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spiegelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer Instrumentalisierung, die mit einem derartigen Gesamtwerk verknüpft ist. Dies wird in einigen Beiträgen dieses Bandes verhandelt.
Brisanter ist die redliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer stand ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk und die Konfiszierung seines halben Vermögens als Sühne für Nazi-Mitläufertum zur Debatte. Egk ging in die Offensive und beantragte eine Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesamten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Verbrechen ein ursächlicher Zusammenhang nachzuweisen sei. Diese infame Wendung führt mitten hinein in die Debatte um Ästhetik und Politik. Es wird in diesem Band geklärt, welche ästhetischen Phänomene Egks Musik dominieren, wie sie zu bewerten und zu politischen Fakten und Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Die Aufgabe ist schwierig, aber sie anzugehen lohnt.
1;Vorwort;10
2;Von Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft. Werner Egk, Carl Orff und das Festspiel Olympische Jugend;14
3;Aktiv im kulturellen Wiederaufbau. Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933;42
4;Werner Egk in Paris: Musiktheater im Kontext der Besatzungspolitik;79
5;Entnazifizierung und Rehabilitierung. Vergangenheitsaufarbeitung im Fall Egk;112
6;Kontext und Hintergründe eines Skandals;128
7;Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas;143
8;Quantität als Qualität. Werner Egks Opern und die gemäßigte Moderne der fünfziger Jahre;156
9;"... und dazu ein nicht zu übersehendes, höchst aktuelles Element." Werner Egks Oper Die Verlobung in San Domingo zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung am 27. November 1963;171 1;Vorwort;10
2;Von Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft. Werner Egk, Carl Orff und das Festspiel Olympische Jugend;14
3;Aktiv im kulturellen Wiederaufbau. Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933;42
4;Werner Egk in Paris: Musiktheater im Kontext der Besatzungspolitik;79
5;Entnazifizierung und Rehabilitierung. Vergangenheitsaufarbeitung im Fall Egk;112
6;Kontext und Hintergründe eines Skandals;128
7;Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas;143
8;Quantität als Qualität. Werner Egks Opern und die gemäßigte Moderne der fünfziger Jahre;156
9;"... und dazu ein nicht zu übersehendes, höchst aktuelles Element." Werner Egks Oper Die Verlobung in San Domingo zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung am 27. November 1963;171
2;Von Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft. Werner Egk, Carl Orff und das Festspiel Olympische Jugend;14
3;Aktiv im kulturellen Wiederaufbau. Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933;42
4;Werner Egk in Paris: Musiktheater im Kontext der Besatzungspolitik;79
5;Entnazifizierung und Rehabilitierung. Vergangenheitsaufarbeitung im Fall Egk;112
6;Kontext und Hintergründe eines Skandals;128
7;Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas;143
8;Quantität als Qualität. Werner Egks Opern und die gemäßigte Moderne der fünfziger Jahre;156
9;"... und dazu ein nicht zu übersehendes, höchst aktuelles Element." Werner Egks Oper Die Verlobung in San Domingo zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung am 27. November 1963;171 1;Vorwort;10
2;Von Weltoffenheit zur Idee der NS-Volksgemeinschaft. Werner Egk, Carl Orff und das Festspiel Olympische Jugend;14
3;Aktiv im kulturellen Wiederaufbau. Werner Egks verschwiegene Werke nach 1933;42
4;Werner Egk in Paris: Musiktheater im Kontext der Besatzungspolitik;79
5;Entnazifizierung und Rehabilitierung. Vergangenheitsaufarbeitung im Fall Egk;112
6;Kontext und Hintergründe eines Skandals;128
7;Freiheit der Kunst? Der Fall Abraxas;143
8;Quantität als Qualität. Werner Egks Opern und die gemäßigte Moderne der fünfziger Jahre;156
9;"... und dazu ein nicht zu übersehendes, höchst aktuelles Element." Werner Egks Oper Die Verlobung in San Domingo zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung am 27. November 1963;171
Werner Egk war ein Mann von ungewöhnlicher Reputation: Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, Präsident des Deutschen Musikrates und Vorstandsvorsitzender der GEMA, sowie Präsidenten der CISAC, der internationalen Dachorganisation für den Schutz der Urheberrechte Ausweis des Ansehens und Vertrauens, das Werner Egk in der Kulturpolitik genoß.Ähnliches gilt auch für den Komponisten Egk, wenngleich vor gänzlich anderem Hintergrund. Das Urteil über Egks Bühnenwerke lag von Anbeginn fest: Seine Musik öffnete die Ohren für die Moderne des 20. Jahrhunderts, die während der NS-Zeit aus den Konzertsälen verbannt gewesen war. Irrtum: Egks Musik entspricht keineswegs jener musikalischen Moderne, die unter das Nazi-Verdikt fiel. Sie repräsentiert vielmehr mit geringen Modifikationen jenen Musikstil, den Egk auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertrat. Daß solche Musik nach 1945 in den Rang von moderner Musik aufzusteigen vermochte, spiegelt das Spannungsverhältnis von ästhetischer Wertung und kulturpolitischer Instrumentalisierung, die mit einem derartigen Gesamtwerk verknüpft ist. Dies wird in einigen Beiträgen dieses Bandes verhandelt.Brisanter ist die redliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Vor der Spruchkammer stand ein fünfjähriges Berufsverbot für Egk und die Konfiszierung seines halben Vermögens als Sühne für Nazi-Mitläufertum zur Debatte. Egk ging in die Offensive und beantragte eine Erhöhung des Strafmaßes auf zehn Jahre und auf Einziehung seines gesamten Vermögens, falls zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und den KZ-Verbrechen ein ursächlicher Zusammenhang nachzuweisen sei. Diese infame Wendung führt mitten hinein in die Debatte um Ästhetik und Politik. Es wird in diesem Band geklärt, welche ästhetischen Phänomene Egks Musik dominieren, wie sie zu bewerten und zu politischen Fakten und Entscheidungen in Beziehung zu setzen sind. Die Aufgabe ist schwierig, aber sie anzugehen lohnt.